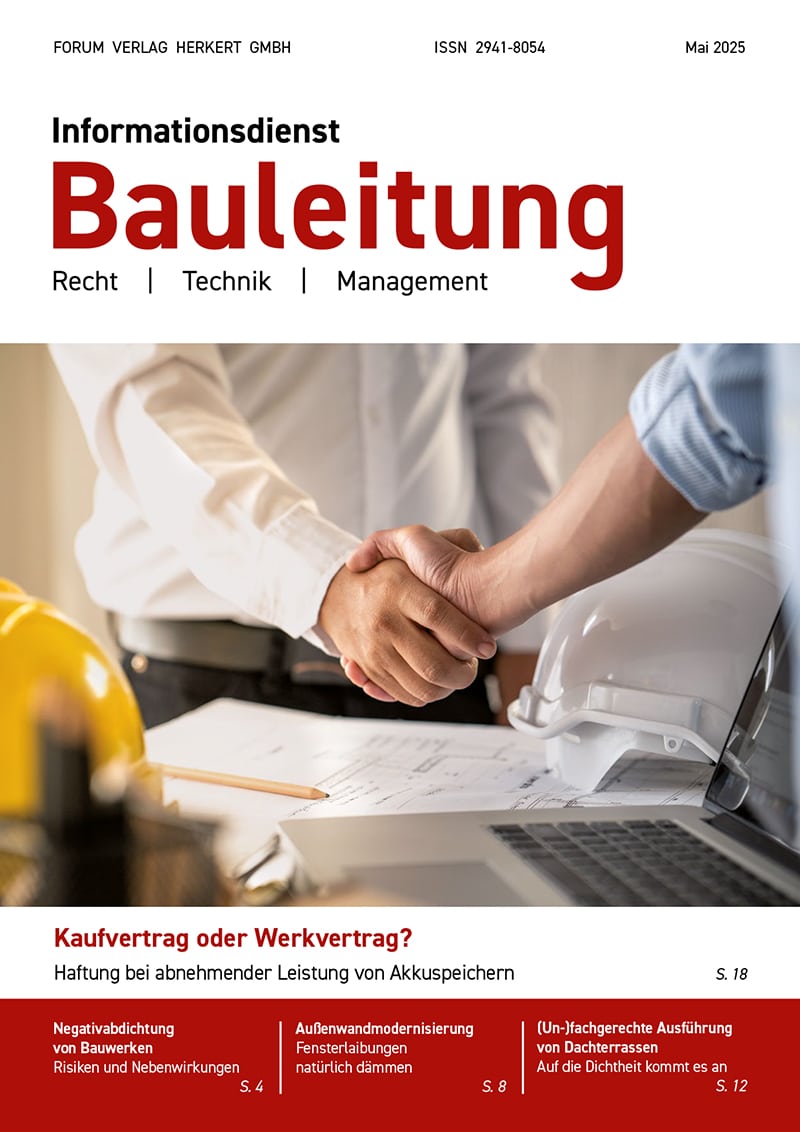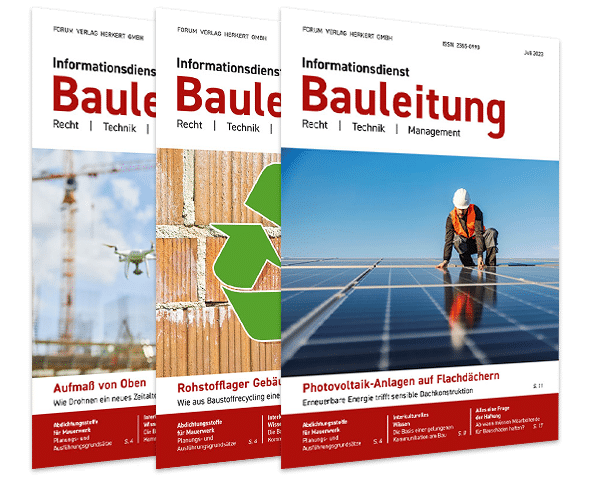BAURECHT
Haftung bei Leistungsreduktionen der Akkuspeicher einer PV-Anlage: Kaufvertrag oder Werkvertrag?
Text: Ulrike Gantert | Foto (Header): © Sebastian Duda – stock.adobe.com
Wenn es um Lieferung und Installation von PV-Anlagen geht, entstehen im Streitfall schnell rechtliche Fragen. Insbesondere hinsichtlich der Vertragsart und möglichen daraus resultierenden Mängelrechten. Die Unterscheidung zwischen Kaufverträgen mit Montageverpflichtung und Werkverträgen beeinflusst die Haftungspflicht von Lieferanten und Installateuren. Deshalb ist es erforderlich, sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen im Klaren zu sein. In diesem Beitrag wird daher die Rechtslage anhand einer beispielhaften Rechtsprechung analysiert.
Auszug aus:
Informationsdienst Bauleitung
Ausgabe Mai 2025
Jetzt Leser/-in werden
INHALTE DES BEITRAGS
Sachverhalt
Das Landgericht Magdeburg musste sich jüngst mit einem Vertrag vom 14.04.2022 befassen (LG Magdeburg, Urt. v. 28.11.2024 – 10 O 563/23), wonach sich die Beklagte zur Installation einer PV-Anlage nebst einem Akkuspeichers verpflichtete, wobei ein Kaufpreis für den Speicher von 12.250 Euro vereinbart wurde.
Zudem erwarb der Kläger eine Garantieverlängerung des Speichers von 10 auf 20 Jahre für 2.499 Euro, ein Technikpaket für 593,81 Euro und eine Wallbox für 2.973,81 Euro. Die Beklagte lieferte und montierte am 02.08.2022 den Akkuspeicher, und am 26.10.2022 wurde die gesamte PV-Anlage nebst Akkuspeicher in Betrieb genommen.
In den Jahren 2022/2023 kam es zu Fernabschaltungen und Leistungsreduktionen der Speicherkapazität des Akkuspeichers durch die Herstellerin des Speichers, nachdem es mehrere Brandvorfälle gegeben hatte; am 09.08.2023 beschränkte sie die Ladekapazität des Akkuspeichers mittels internetgesteuertem Fernwartungszugriff dauerhaft auf ca. 70 % der Gesamtspeicherkapazität.
Der Kläger forderte die Beklagte daraufhin mit Schreiben vom 25.03.2024 zur uneingeschränkten und sicheren Inbetriebnahme des Akkuspeichers auf. Die Beklagte regierte jedoch nicht.
Der Kläger erklärte sodann mit anwaltlichem Schreiben vom 09.04.2024 gegenüber der Beklagten den teilweisen Rücktritt vom Vertrag hinsichtlich des Akkuspeichers, die verbaute PVAnlage nutzte er weiter. Später verlangte er zusätzlich die Rücknahme der Wallbox, forderte die Beklagte zur teilweisen Rückerstattung des Kaufpreises auf und bot ihr die Abholung des Akkuspeichers an. Vor Gericht beantragte der Kläger, die Beklagte zu verurteilen, an ihn 18.316,62 Euro nebst Zinsen Zug um Zug gegen Übergabe des Akkuspeichers sowie der Wallbox zu zahlen.
Die Beklagte beantragte Klageabweisung und berief sich darauf, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass es zu Bränden/Verpuffungen der Speicher kommen könne und dies durch das allgemeine Technologierisiko unausweichlich sei. Um dieses geringe Risiko noch weiter zu minimieren, sei die Drosselung erfolgt.
Entscheidung des Gerichts
Der Kläger hat gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf Kaufpreisrückzahlung Zug um Zug gegen Übergabe des Akkuspeichers. Ihm steht gem. § 323 Abs. 1 BGB ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, wenn bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbringt und der Gläubiger erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung bestimmt hat.
Das Gericht stellt fest, dass die Parteien einen Kaufvertrag mit Montageverpflichtung geschlossen haben, keinen Werkvertrag:
„Zur Abgrenzung ist […] eine Gesamtbetrachtung anhand des Schwerpunkts der Leistung vorzunehmen, wobei besonders auf die Art des zu liefernden Gegenstands, das Wertverhältnis von Lieferung und Montage sowie auf die im Einzelfall geschuldeten Ergebnisse abzustellen ist.
Maßgebend für eine Abgrenzung zwischen Kauf- und Werkvertrag ist, welcher Bestandteil des jeweiligen Vertragstypus vordergründig und damit vertragsprägend ist. Hinsichtlich eines Kaufvertrags wäre dies die Eigentumsübertragung der zu montierenden Einzelteile, hinsichtlich eines Werkvertrags die Herstellungspflicht eines individuellen Werks.
Bezüglich der Art des gelieferten Gegenstandes ist relevant, ob die Anlage aus Serienteilen oder aus an die jeweiligen Besonderheiten angepassten typisierten Einzelteilen, die nach der Montage nur noch schwer anderweitig absetzbar wären, besteht (vgl. BGH, Urt. v. 03.03.2004, Az. VIII ZR 76/03).
Eine solche typenspezifische Modifizierung der Photovoltaikanlage sowie nutzungsnotwendiger Komponenten ist nicht ersichtlich. Die gelieferten und verbauten Photovoltaikkomponenten sind serienmäßig hergestellte Bauteile anderer Hersteller.
Der […] Akkuspeicher ist ebenso serienmäßig und wird in selbiger Ausführung regelmäßig von der Streitverkündeten vertrieben. Die Streitverkündete führt in ihrem Schriftsatz vom 22.07.2024 selbst aus, dass es sich seinerzeit um einen Speicher von insgesamt 66.000 deutschlandweit verbauten Speichern mit Fernschaltung handelt.
Keinesfalls handelt sich um ein Unikat bzw. Einzelstück mit besonderer Fertigung für den Kläger. Der Gesamtpreis inklusive Montage belief sich auf 42.828,10 Euro […]. Ausweislich des Angebots vom 08.04.2022 liegt zwar eine gesonderte Zahlung für die Montage vor, nämlich 2.500 Euro (netto). Jedoch ist der berechnete Preis lediglich ein Bruchteil von dem Gesamtpreis.
Inhaltlich werden die einzelnen Komponenten bestimmt, bei denen wiederum weitestgehend eine Montage am gewünschten Platz des Klägers inklusive war.
Der prägende Vertragsinhalt ist damit die Eigentumsübertragung der Photovoltaikanlage mit den dazugehörigen Komponenten. Insgesamt ist nach einer Gesamtbetrachtung der Erwerb der Gesamtanlage für den Vertragstypus entscheidend.
Hinsichtlich der Abgrenzung ist auch maßgebend, dass die Photovoltaikanlage auf ein bestehendes Wohngebäude verbaut wurde, bei dem die einzelnen Paneele der Anlage zusammengesetzt wurden. Mittels standardisierter Stromkabel wurde eine Verbindung zwischen der Photovoltaikanlage und dem Akkuspeicher geschaffen.
Dabei wurde keinesfalls ein für den Kläger individuelles Werk geschaffen. Die Photovoltaikanlage ist damit hypothetisch von dem Wohnkomplex des Klägers zu trennen und auf einem anderen Dach einsetzbar. Zudem konnte der Kläger auch den Akkuspeicher einfach tauschen und durch einen selbstgewählten Speicher ersetzen.
Der Akkuspeicher ist mangelhaft, weil er bei Gefahrenübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen nicht entsprach. Denn vereinbart war der Einbau einer Speicherbatterie mit einer Speicherkapazität von 10 kWh, tatsächlich wurden dem Kläger lediglich 50 bis 70 % der Ladekapazität bereitgestellt. „Zwar ist die Fernwartung zwischen den Parteien vereinbart […] Jedoch gewährt die Überwachung keine Berechtigung der Drosselung des Akkuspeichers des Klägers.“
Schließlich hatte der Kläger die Beklagte erfolglos mit Schreiben vom 09.04.2024 zur Nacherfüllung aufgefordert.
Fazit
Zur Abgrenzung des Kaufvertrags mit Montageverpflichtung vom Bauvertrag kommt es maßgeblich darauf an, wo der Schwerpunkt des Vertrags liegt. Liegt er auf der Pflicht zur Eigentumsübertragung der zu montierenden Einzelteile oder auf der Montageverpflichtung und dem damit verbundenen individuellen Gesamterfolg? Weitere Bedeutung haben die Art des gelieferten Gegenstands, das Wertverhältnis von Lieferung und Montage und etwaige Besonderheiten der geschuldeten Leistung.
Nach einem (nicht rechtskräftigen) Urteil des LG Rostock sind Photovoltaik-Aufdachanlagen als Bauwerke zu qualifizieren (vgl. LG Rostock, Urt. v. 18.12.2024 – 2 O 316/24 [nicht rechtskräftig]; Berufung: OLG Rostock, Az. 4 U 45/25). Ein Vertrag über die Lieferung und Montage einer Photovoltaik-Aufdachanlage wäre damit als Bauvertrag zu qualifizieren.
Die Unterscheidung ist u. a. deswegen wichtig, weil die Mängelrechte in beiden Fällen unterschiedlich sind (vgl. § 437 BGB versus § 634 BGB).
Die Autorin
Ulrike Gantert ist Rechts- und Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht sowie Schlichterin und Schiedsrichterin für Baustreitigkeiten (SO-Bau). Seit 1994 ist sie im Immobilienrecht tätig. Sie hält Vorträge und Seminare zu bau- und architektenrechtlichen Themen und ist u. a. Mitherausgeberin des im Forum Verlag erschienenen Loseblattwerks „VOB und BGB am Bau“.